In eigener Sache:
Unterstütze die Transformation der Automobilindustrie
"Wie kann ich deine Arbeit unterstützen?"
Diese Frage erreicht mich regelmäßig.
Die Antwort ist einfach: Werde Autopreneur Pro Abonnent.
Was macht meinen Blick auf die Branche besonders? Als unabhängiger Analyst kann ich offen ansprechen, was andere nicht sagen können oder dürfen. Ohne Abhängigkeiten von OEMs, Zulieferern oder Dienstleistern.
Mit einem Pro-Abo erhältst du nicht nur Premium-Content und tiefere Einblicke. Du beschleunigst auch die Transformation der Branche.
Herzlich willkommen zur 77. Ausgabe von Der Autopreneur!
Eine aktuelle McKinsey-Studie zeigt:
Klassische OEMs brauchen im Schnitt 40-50 Monate, um eine neue Fahrzeug-Software zu entwickeln.
Neue Autobauer wie Tesla & BYD entwickeln ein komplettes Fahrzeug (inkl. Software) in 24-30 Monaten. Einzelne chinesische Player schaffen Best-Cases in 18 Monate.
Dieser Speed-Unterschied wird zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor. Das haben auch deutsche Hersteller erkannt. Sie investieren immer mehr in Software. VW allein hat über 12 Milliarden Euro in CARIAD gesteckt.
Trotzdem wächst der Software-Gap zwischen traditionellen Herstellern und neuen Playern. Heute schauen wir uns an, warum etablierte Hersteller bei Software zurückliegen. Und was sie dagegen tun können.

KI-generiertes Symbolbild
Warum Software im Auto wichtig ist
Zuerst mal: Wenn wir über Auto-Software reden, meinen wir normalerweise nicht das Infotainment.
Software steuert mittlerweile fast alles im Fahrzeug:
Antrieb und Bremsen
Akku- und Energiemanagement
Fahrdynamik und Assistenzsysteme
OTA-Updates und Apps
In der Vergangenheit wurden schon zahlreiche Modell-Starts wegen Software-Problemen verzögert:
Audi Q6 e-tron (16 Monate)
Porsche Macan (12 Monate)
Volvo EX90 (6 Monate)
Ford Explorer EV (6 Monate)
Das zeigt: Software bestimmt heute den Zeitplan der Fahrzeugentwicklung. Wer hier langsam ist, verliert.
Das V-Modell als fundamentales Problem
Traditionelle OEMs entwickeln Fahrzeuge nach dem klassischen V-Modell:

Das V-Modell der Autoindustrie (McKinsey)
Links sehen wir die Anforderungen und das Design. Unten die Implementierung. Rechts die Tests und Integration.
Dieses Modell stammt aus den 70er Jahren und wurde für Hardware-Entwicklung optimiert. Es hat 2 fundamentale Schwächen für Software:
Silos. Teams arbeiten isoliert. Wer Anforderungen definiert, ist nicht an Tests beteiligt.
Wasserfall (statt agil). Jede Phase muss weitgehend abgeschlossen sein, bevor die nächste beginnt. Feedback kommt erst spät.
Ein konkretes Beispiel für diese Silos: Einkauf und Entwicklung kommunizieren oft schlecht. Der Einkauf verhandelt mit Zulieferern, ohne die technischen Anforderungen vollständig zu verstehen.
Die Produktvielfalt bremst alles aus
Ein oft übersehenes Problem: Die Produktvielfalt traditioneller Hersteller ist bis zu 150x größer als die der neuen Wettbewerber.
Was bedeutet das konkret? Ein traditioneller OEM muss:
Dutzende verschiedene Modelle unterstützen
Verbrenner-, Elektro- und Hybrid-Antriebe parallel entwickeln
Mehrere Software-Plattformen gleichzeitig pflegen
Diverse Märkte mit unterschiedlichen Anforderungen bedienen
Die Folge: Jede Software-Änderung muss mit unzähligen Varianten kompatibel sein. Das kostet super viel Geld. Und macht sehr langsam.
4 strukturelle Probleme laut McKinsey
1) Veraltete Entwicklungstools
Tech-Unternehmen setzen auf durchgängige, automatisierte Prozesse. Traditionelle OEMs nutzen oft einen Flickenteppich verschiedener Tools. Ein System für Anforderungen, ein anderes für Testfälle, ein drittes für Fehlerberichte. Jede Schnittstelle wird zum Bottleneck.
2) Mangelhaftes Projektmanagement
Oft existieren mehrere, teils widersprüchliche Pläne für einzelne Feature-Bereiche. Niemand hat den Gesamtüberblick.
3) Hardware-Methoden für Software-Entwicklung
Die traditionellen Prozesse wurden für Hardware entwickelt. Sie passen nicht zur iterativen, schnellen Natur von Software-Entwicklung. OEMs haben versucht, Software in bestehende Hardware-Prozesse "hineinzuwurschteln" anstatt neue Software-Prozesse zu etablieren.
4) Intransparente Prozesse
Qualitätskriterien werden im Laufe der Entwicklung oft geändert. Was anfangs akzeptiert wurde, fällt später in Tests durch. Dadurch verzögern sich Produktionsstarts um Monate.
Der Talent-Gap
Ein unterschätztes Problem: Der Mangel an Software-Talenten. Der deutsche Automotive-Sektor verzeichnet seit 2013 zwar einen Anstieg der IT-Stellen um 85%. Trotzdem verschärft sich die Lage.
Denn bei Software konkurrieren Autobauer plötzlich mit Tech-Companies um dieselben Talente.
Ein konkretes Beispiel: Xiaomi hat neulich ein Entwicklungszentrum in München eröffnet. Und zum Start haben sie erst mal 5 Manager von BMW abgeworben.
Das Problem liegt aber noch tiefer. Die Strukturen deutscher Konzerne sind nicht für Software-Talente gemacht:
Die Tarifstruktur der IG Metall begrenzt viele auf etwa 85.000-95.000 €. Darüber kommt man meist nur mit Personalverantwortung. Google Deutschland zahlt im Schnitt 165.000 €
Das System sieht keine Fachkarriere vor. Historisch zählt Führungsverantwortung. BMW startete erst 2018 eine "Expert Career" für Spezialisten ohne Personalverantwortung
Remote-First-Modelle werden oft blockiert. Ein No-Go für viele Software-Talente
Die Folge: In vielen OEMs steuern traditionelle Ingenieure ohne Software-Hintergrund die Software-Entwicklung. Die können zwar Zulieferer managen. Ihnen fehlt aber häufig das Software-Know-how.
Was die neuen Autobauer anders machen
Tesla behebt 99% seiner Rückrufe per OTA-Update. Das ist kein Zufall, sondern das Ergebnis eines grundlegend anderen Entwicklungsansatzes.
Die neuen Autobauer:
Setzen auf Software-first-Entwicklung
Arbeiten mit integrierten Hardware-Software-Teams
Nutzen kurze, ein- bis zweiwöchige Entwicklungssprints
Setzen auf hohe Code-Wiederverwendung
Der entscheidende Punkt: Sie verstehen sich als Software-Unternehmen, das Autos baut. Nicht als Autobauer, der Software nutzt.
5 Hebel für schnellere Software-Entwicklung
Ich habe 5 Hebel identifiziert, mit denen traditionelle Autobauer bei Software schneller werden können:
1) Software-first denken
Software muss von Anfang an im Mittelpunkt der Entwicklung stehen. Nicht erst nach der Hardware. Das bedeutet auch: Software-Experten gehören in Führungspositionen. Sie sollten der Standard sein, nicht die Ausnahme.
2) Entwicklungsprozesse neu denken
Software lässt sich virtuell testen. Schnelles Feedback statt monatelanger Testzyklen spart Zeit und Geld.
3) Talent & Kultur neu denken
Neue Karrierewege abseits der bestehenden starren Strukturen schaffen. Inkl. marktgerechter Vergütung.
4) Weniger Modelle, weniger Varianten
Jede unnötige Vielfalt kostet Entwicklungszeit. Ein gemeinsames Betriebssystem für alle Fahrzeuge eines Konzerns sollte das Ziel sein.
5) Kooperationen ausbauen
McKinsey empfiehlt eine industrieweite Zusammenarbeit ähnlich dem Airbus-Modell. D.h. deutsche OEMs sollten gemeinsam Software entwickeln. S-CORE ist ein 1. Schritt in diese Richtung, wie ich vor 2 Wochen berichtet hatte.
Mein Take
Die Kernprobleme der deutschen Hersteller sind nicht technisch. Sie sind organisatorisch und kulturell.
Die gute Nachricht: Wir können das Problem lösen. Die schlechte: Es braucht eine ganzheitliche Transformation.
3 Punkte sind besonders wichtig:
Software-Probleme verzögern neue Modelle um Monate. Jeder Monat kostet Millionen
Das V-Modell stammt aus der Hardware-Ära. Es muss für agile Software-Entwicklung neu gedacht werden
Unsere starren, gewachsenen Strukturen blockieren mal wieder den Wandel. Die Personalstruktur ist fürs letzte Jahrhundert gemacht, nicht für die Software-Ära. Damit stehen wir uns selbst im Weg und verlieren im Wettbewerb um die besten Talente
McKinsey bestätigt: Software wurde in bestehende Prozesse "hineingewurschtelt", statt die Prozesse für Software neu zu definieren. Wir versuchen also, Software mit Hardware-Methoden zu entwickeln. Das ist, als würde man versuchen, mit einem Hammer zu stricken.
Es reichen keine Einzelmaßnahmen. Wir brauchen eine komplette Transformation. Vom Industriekonzern zur Software-first Company.
PS: Wie immer bespreche ich das Thema noch etwas ausführlicher im begleitenden Podcast.
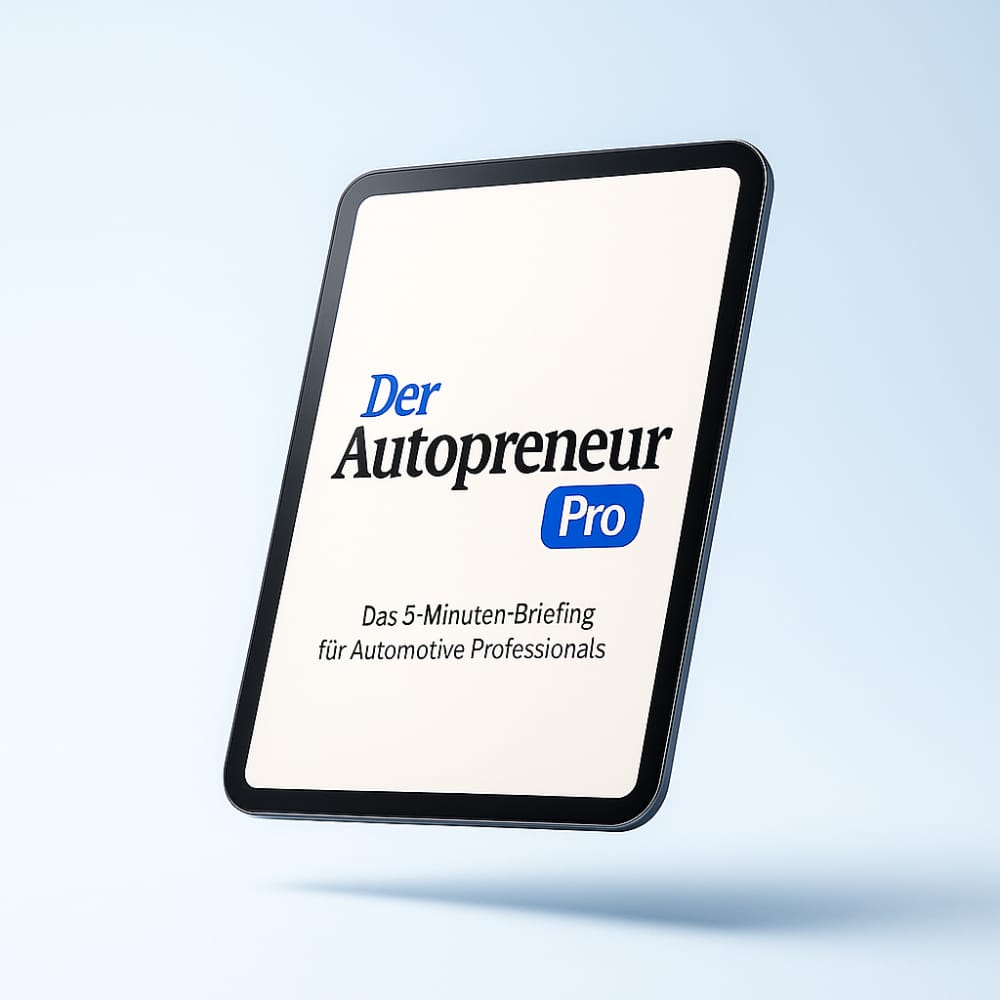
Warum ich bei Mercedes jeden Tag frustrierter wurde…
2019. Mein letztes Jahr bei Mercedes.
Mein größtes Problem?
8 Stunden Meetings am Tag. Hunderte ungelesene Mails. Newsletter. LinkedIn-Posts. Der volle Info-Overload.
Mein Anspruch: Über alles Bescheid wissen.
Die Realität: Ich hatte null Zeit dafür.
Dieses Problem haben heute 90% aller Automotive-Professionals.
Ein klassischer Zielkonflikt: Um die richtigen Entscheidungen zu treffen, musst du gut informiert sein. Aber das Tagesgeschäft firsst dich komplett auf.
Ich kenne dieses Gefühl zu gut. Es hat mich wahnsinnig gemacht.
Deshalb habe ich 'Der Autopreneur Pro' entwickelt.
Das 5-Minuten-Briefing, das dir 8 Stunden Recherche spart.
✓ Jeden Mittwoch alle wichtigen Updates
✓ Ohne Bullshit - nur was wirklich zählt
✓ Mit meiner Einordnung als Insider
Resultat: Bessere Entscheidungen. Weniger Stress. Und ein klarer Vorteil für deine Karriere.
📊 Aktien-Performance
⎯⎯
Hier die Wochenperformance der wichtigsten Automotive-Werte:

Woche Δ: Kursveränderung der letzten Woche
YTD Δ: Kursänderung seit Jahresbeginn
Verstehen, was hinter diesen Zahlen steckt? Mein Automotive-Intelligence Briefing liefert alle Hintergründe.
Das war’s für heute:

Bis zum nächsten Mal,
— Philipp Raasch
Weitere Optionen:
Newsletter Weiterempfehlen (ab 5 Referrals, 1 Monat Pro gratis)
Hier findest du alle weiteren Links zu mir
