Anzeige
Diese Transformation übersehen die meisten in der Auto-Industrie
Wir reden über E-Autos, Software und autonomes Fahren. Das ist wichtig.
Aber eine der größten Challenges liegt woanders. In der Karosserie.
Früher wurden Karosserien aus 170+ Einzelteilen zusammengeschweißt. Heute ersetzen Hersteller diese durch ein einziges Gussteil. Das nennt sich Megacasting.
Und das ist nur ein Beispiel von vielen.
Das Problem? Jeder arbeitet im Geheimen. Kaum Austausch zwischen den Herstellern.
Genau das ändert sich vom 14.-16.10. in Bad Nauheim bei der EuroCarBody 2025.
Dort treffen sich 500 Top-Ingenieure von BYD, Geely, Audi, BMW und Lucid.
Sie präsentieren ihre neuesten Karosserien live zum Anfassen. Herstellerübergreifend lernen statt gegeneinander arbeiten.
Herzlich willkommen zur 88. Ausgabe von Der Autopreneur.
Ich bin ja gerade in Japan. Von hier schaue ich mit etwas Abstand auf die Debatte in Deutschland.
Eine Debatte, die wir in dieser Emotionalität wirklich nur in Deutschland führen.
Auf der IAA haben deutsche Autobauer ihre bis dato besten E-Autos gezeigt. Viele Experten sagen: Endlich die überzeugende Antwort auf Tesla und China.
Gleichzeitig passierte aber was anderes. In Brüssel lobbyierten die CEOs derselben Unternehmen bei der EU. Sie wollen länger Verbrenner verkaufen dürfen.
BMW-Chef Oliver Zipse warnt: Die deutsche Autoindustrie könnte "um die Hälfte schrumpfen", falls das Verbrenner-Aus 2035 bestehen bleibt.
Markus Söder fordert, das Aus komplett zu kippen. Andere schließen sich an.
Das sorgte bei einigen für Verwirrung. Was ist jetzt die Strategie? An welche Technologien glauben diese Unternehmen wirklich?
Die Antwort: An alle. Und genau das ist das Problem.
Heute will ich den Begriff “Technologieoffenheit” auseinandernehmen. Was steckt wirklich dahinter? Und warum ist diese Strategie genau das Gegenteil von mutig?

Was bedeutet Technologieoffenheit eigentlich?
Der Begriff klingt erst mal positiv. Flexibel. Zukunftsoffen.
Konkret bedeutet es: Man entwickelt parallel mehrere Antriebstechnologien. Verbrenner. E-Autos. Wasserstoff. E-Fuels. Plug-in-Hybride. Alles gleichzeitig.
Die Befürworter argumentieren: Das ist Pragmatismus. Wir passen uns an unterschiedliche Kundenbedürfnisse an. Wir reduzieren Risiken.
BMW betont: Technologieoffenheit erhöht die Resilienz.
Porsche hat gerade einen Strategiewechsel hinter sich. Vom starken Fokus auf E-Autos zurück zu mehr Verbrennern.
Porsche selbst begründet die Kehrtwende so: Risiko und mutige Entscheidungen gehören eben zur Porsche-DNA.
Die Botschaft dahinter: Andere setzen einseitig auf eine Technologie. Wir sind mutig genug, auch andere Wege zu gehen. Gegen den Strom zu schwimmen.
In Wahrheit ist es genau andersherum.
Technologieoffenheit ist die risikoaverseste Strategie
Ein wirklich mutiger Schritt wäre eine klare Zukunftswette.
Zu sagen: Wir glauben an diese Technologie. Wir setzen voll darauf. Wir investieren all unsere Ressourcen, um hier führend zu werden.
Technologieoffenheit ist dagegen die risikoaverseste Strategie, die man fahren kann.
Man traut sich keine klare Entscheidung zu. Man hat keine Vision davon, wie die Zukunft aussehen wird. Stattdessen sichert man sich in alle Richtungen ab.
Es ist die perfekte Verkörperung dessen, was international als "German Angst" bekannt ist. Die typisch deutsche Neigung, vor lauter Risikoabwägung lieber auf Nummer Sicher zu gehen.
Ein wirklich mutiger Move von Porsche wäre gewesen zu sagen: Wir lassen das mit den E-Autos. Wir bleiben langfristig beim Verbrenner und setzen voll auf E-Fuels.
Aber genau das machen sie nicht.
Man bleibt in der Mitte. Hält sich alle Wege offen. Wartet ab.
Das Problem: Diese Absicherung ist extrem teuer.
Jede Antriebstechnologie braucht eigene Entwicklungsteams. Eigene Fertigungslinien. Eigene Zulieferstrukturen.
Ein neuer Antriebsbaukasten kostet rund 10 Mrd. Euro.
Wer mehrere parallel entwickelt, multipliziert diese Kosten.
Die Gefahr: Während Wettbewerber ihre gesamten Ressourcen auf eine Technologie fokussieren, verzettelt man sich.
Man investiert gleichzeitig in die Gewinner und in die Verlierer.
Nokia, Blackberry und Kodak haben das schon durchgemacht
2007 stellt Apple das iPhone vor.
Nokia und Blackberry sind zu dem Zeitpunkt noch Marktführer. Beide erkennen: Diese Smartphones könnten die Zukunft sein.
Aber sie trauen sich auch nicht “All in” zu gehen.
Stattdessen entwickeln sie parallel weiter klassische Handys. Und versuchen gleichzeitig, Smartphones zu bauen.
Sie wollen sich nicht festlegen. Halten sich alle Optionen offen.
Das Ergebnis? Beide sind vom Markt verschwunden.
Oder Kodak.
1975 erfinden sie die erste Digitalkamera. Aber sie trauen sich nicht, voll darauf zu setzen.
Warum? Weil ihr gesamtes Geschäftsmodell auf Analog-Film basiert.
Also entwickeln sie parallel beide Technologien. Digitalkameras. Und Analog-Film.
Strategische Zurückhaltung statt mutiger Wette auf die Zukunft.
Das Ergebnis? 2012 mussten sie Insolvenz anmelden.
Genau das ist das Problem bei Technologieoffenheit. Man hat keine klare Vision für die Zukunft. Man verteilt Ressourcen auf alles.
Und verliert am Ende gegen die, die fokussiert investieren.
So entwickeln sich die Märkte
Schauen wir uns die Zahlen an:
Diesel: Der Anteil bei Neuwagen in Europa ist von 52% (2015) auf unter 12% (2024) gefallen. In den USA und China ist die Technologie praktisch tot.
Wasserstoff-PKW: 2024 wurden weltweit nur 12.866 Brennstoffzellenfahrzeuge verkauft. Ein Rückgang von über 20%. Zum Vergleich: Im selben Jahr wurden 10,8 Mio. batterieelektrische Fahrzeuge verkauft.
E-Fuels: Eine Analyse prognostiziert für 2035 in der EU genug Produktion für 2% der Fahrzeugflotte. Außerdem braucht man 5x mehr Strom als bei einem E-Auto.
Was die EU beschlossen hat
Es herrscht viel Verwirrung darüber, was die EU eigentlich beschlossen hat. Deshalb hier die Fakten:
Ab 2035 dürfen in der EU nur noch Neuwagen zugelassen werden, die 0 Gramm CO₂ pro Kilometer ausstoßen. Das betrifft ausschließlich Neuzulassungen
Bestehende Verbrenner dürfen unbegrenzt weitergefahren werden. Sie können verkauft, repariert und gewartet werden. Niemand muss sein Auto 2035 verschrotten
Es gibt eine Ausnahme: Fahrzeuge mit E-Fuels können auch nach 2035 neu zugelassen werden. Aber: Sie müssen technisch sicherstellen, dass kein fossiler Kraftstoff getankt werden kann
Wichtig ist auch: Das Jahr 2035 ist nicht das einzige Ziel. Bis 2030 müssen die CO₂-Emissionen bei Neuwagen bereits um 55% gegenüber 2021 sinken.
Dieses Zwischenziel ist der eigentliche Game Changer. Es zwingt die Industrie jetzt zum Handeln.
Was China anders macht
Viele deutsche CEOs fordern jetzt ein Modell wie in China.
Was macht China anders?
China hat kein Verbrenner-Aus beschlossen. Trotzdem liegt der E-Auto-Anteil dort bei über 50%.
Wie haben sie das geschafft?
Mit einem System aus Anreizen und Zwängen.
Hersteller bekommen Minuspunkte für die Produktion von Verbrennern. Diese müssen sie durch die Produktion von E-Autos ausgleichen. Das System zwingt zu hohen E-Auto-Quoten.
Der entscheidende Unterschied zur EU: Was in China unter einem E-Auto verstanden wird.
China arbeitet mit der Kategorie New Energy Vehicles (NEVs). NEVs umfassen nicht nur batterieelektrische Fahrzeuge, sondern auch Plug-in-Hybride und Range Extender.
Das gibt Herstellern mehr Flexibilität als das europäische 0-Gramm-Ziel ab 2035.
Parallel hat China massiv in Ladeinfrastruktur investiert. E-Autos haben Vorteile bei Zulassungen und Nummernschildern. Kunden bekommen handfeste Kaufanreize.
Der Vorteil gegenüber dem europäischen Modell: Es ist stabiler. Es gibt keinen ständigen politischen Kampf um Aufweichung oder Verschiebung.
Das Problem mit dem Zickzack-Kurs
Kann man also die EU-Strategie kritisieren? Auf jeden Fall.
Das chinesische Modell mit Anreizen statt harten Vorgaben hat besser funktioniert.
Aber: Der Drops ist gelutscht.
Das 2035-Ziel der EU steht. Es ist politisch beschlossen.
Jetzt ständig daran zu rütteln, verschärft das Problem.
Warum? Weil es Konsumenten verunsichert.
Stell dir vor, du willst ein Auto kaufen und es 10 Jahre fahren. Dann liest du ständig widersprüchliche Berichte.
Die Politik diskutiert über Verbrenner-Comebacks. E-Fuels. Wasserstoff.
Dann überlegst du dir 2x, ob du jetzt wirklich ein E-Auto kaufen sollst. Vielleicht wird die Technologie in 5 Jahren nicht mehr unterstützt? Vielleicht gibt es keine Ladeinfrastruktur mehr?
Diese Unsicherheit blockiert den Markthochlauf.
Technologieoffenheit als Unternehmensstrategie
Aber es gibt noch eine zweite Ebene. Und die ist das eigentliche Kernproblem.
Technologieoffenheit als Unternehmensstrategie.
Bei politischen Vorgaben kann man noch diskutieren, welcher Weg besser ist.
Aber als Strategie für Unternehmen?
Da ist Technologieoffenheit maximal problematisch.
Warum? Weil Fokus im Wettbewerb entscheidet.
Wer seine Ressourcen verteilt, kann nirgendwo führend werden.
Wir haben das ja schon bei Nokia, Blackberry und Kodak gesehen.
Die Abwärtsspirale der Unentschlossenheit
Die Kosten der Technologieoffenheit als Unternehmensstrategie führen in eine Abwärtsspirale:
Schritt 1: Fragmentierte Entwicklung
Unternehmen verteilen ihre Ressourcen auf alle Technologien gleichzeitig. Sie investieren in alles. Meistern aber nichts richtig.
Schritt 2: Verunsicherung auf allen Ebenen
Die Industrie sendet gemischte Signale. Nach außen und nach innen.
Das Signal lautet: Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt.
Mitarbeiter fragen sich: In welchem Bereich sollte ich mich spezialisieren?
Investoren fragen sich: Hat das Management eine klare Vision?
Kunden fragen sich: Soll ich jetzt kaufen oder lieber abwarten?
Top-Talente gehen eher zu Unternehmen mit klarer Vision. Investoren bevorzugen Player mit glasklarer Strategie. Potenzielle Käufer sind maximal verunsichert.
Schritt 3: Wettbewerber ziehen davon
Fokussierte Konkurrenten nutzen diese Zeit. Sie bauen ihren technologischen Vorsprung aus. Und gewinnen Marktanteile.
Bosch zeigt das exemplarisch. Man hat breit investiert: In Diesel, Wasserstoff und E-Mobilität. Das Ergebnis: 22.000 Jobs fallen bis 2030 weg. Die Wetten auf Diesel und Wasserstoff sind nicht aufgegangen.
Wenn man parallel in mehrere Technologien investiert, summieren sich die Entwicklungskosten. Das ist der direkte Preis der Technologieoffenheit.
Und es zeigt sich im Preiskampf. Chinesische Hersteller können auch deshalb günstigere Autos anbieten, weil sie fokussierter investieren.
Mein Take
Die Forderung nach Technologieoffenheit kommt primär aus Deutschland.
Warum? Weil wir Jahrzehnte lang in Verbrenner-Technologie investiert haben. Ganze Werke, Zulieferstrukturen und Arbeitsplätze hängen daran.
Ein schnelles Ende des Verbrenners bedeutet: Massive Umstrukturierung. Teure Investitionen. Jobs fallen weg.
Technologieoffenheit verschafft Zeit.
Zeit, um bestehende Investitionen länger auszulasten. Zeit, um Jobs schrittweise statt radikal abzubauen.
Das ist nachvollziehbar. Aber es ist keine Strategie für die Zukunft.
Technologieoffenheit ist nicht das, was der Name verspricht. Es ist keine mutige Vision für eine vielseitige Zukunft. Es ist das Gegenteil.
Es ist der Versuch, am Alten festzuhalten. Es ist die Angst, sich festzulegen.
Ex-VW-Chef Herbert Diess sagt: "Je mehr sich die deutsche Industrie mit auslaufenden Nischentechnologien wie Diesel beschäftigt, desto leichter fällt es chinesischen Unternehmen, ihren Vorsprung auszubauen."
Das Kernproblem ist die fehlende Bereitschaft, Risiko einzugehen.
Deutschland braucht keine Technologieoffenheit. Deutschland braucht Technologieentschlossenheit.
Haben wir den Mut dazu? Oder warten wir so lange ab, bis es kein Risiko mehr gibt? Bis die Entscheidung offensichtlich ist?
Aber dann ist es zu spät. Dann haben die fokussierten Wettbewerber die Märkte bereits erobert.
Wer keine Entscheidung trifft, hat bereits eine getroffen.
Für den Status quo. Gegen die Zukunft.
PS: Wie immer bespreche ich das Thema noch etwas ausführlicher im begleitenden Podcast.
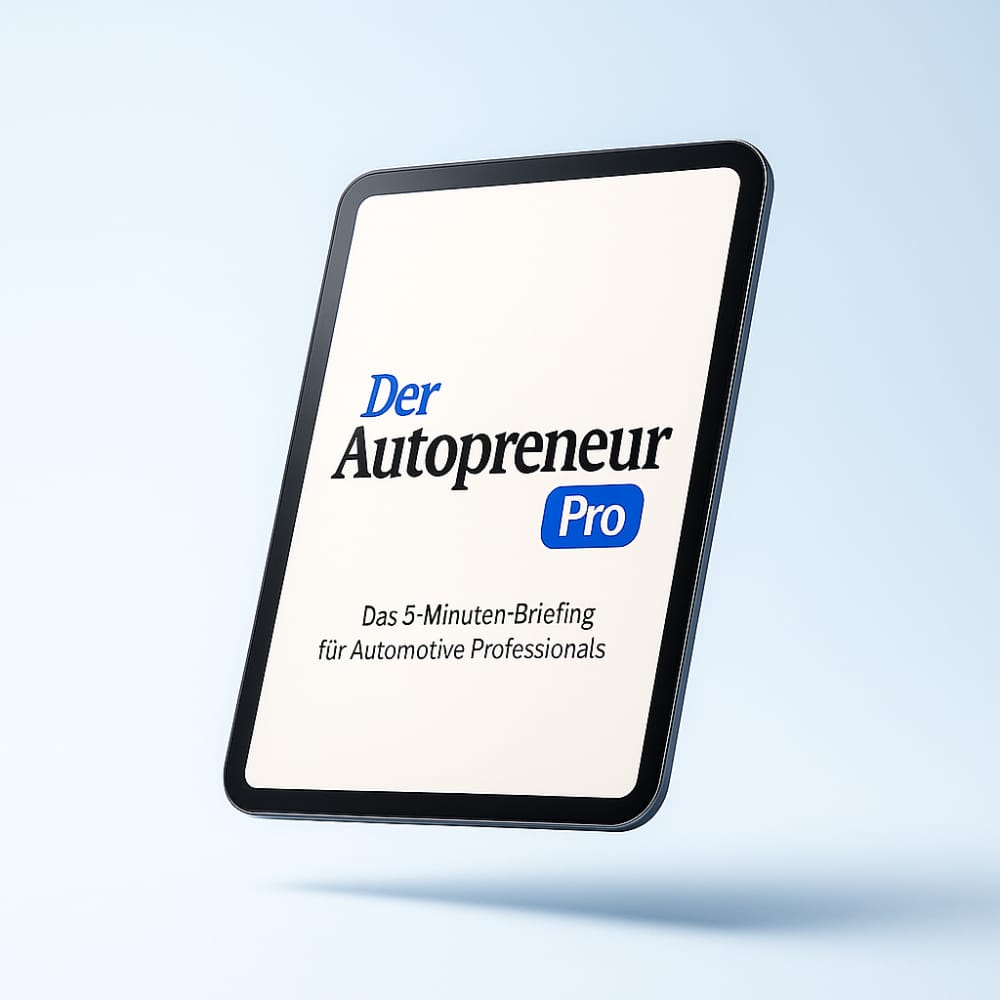
Warum ich bei Mercedes jeden Tag frustrierter wurde…
2019. Mein letztes Jahr bei Mercedes.
Mein größtes Problem?
8 Stunden Meetings am Tag. Hunderte ungelesene Mails. Newsletter. LinkedIn-Posts. Der volle Info-Overload.
Mein Anspruch: Über alles Bescheid wissen.
Die Realität: Ich hatte null Zeit dafür.
Dieses Problem haben heute 90% aller Automotive-Professionals.
Ein klassischer Zielkonflikt: Um die richtigen Entscheidungen zu treffen, musst du gut informiert sein. Aber das Tagesgeschäft firsst dich komplett auf.
Ich kenne dieses Gefühl zu gut. Es hat mich wahnsinnig gemacht.
Deshalb habe ich 'Der Autopreneur Pro' entwickelt.
Das 5-Minuten-Briefing, das dir 8 Stunden Recherche spart.
✓ Jeden Mittwoch alle wichtigen Updates
✓ Ohne Bullshit - nur was wirklich zählt
✓ Mit meiner Einordnung als Insider
Resultat: Bessere Entscheidungen. Weniger Stress. Und ein klarer Vorteil für deine Karriere.
📊 Aktien-Performance
⎯⎯
Hier die Wochenperformance der wichtigsten Automotive-Werte:

Woche Δ: Kursveränderung der letzten Woche
YTD Δ: Kursänderung seit Jahresbeginn
Verstehen, was hinter diesen Zahlen steckt? Mein Automotive Intelligence Briefing liefert die Hintergründe.
Das war’s für heute:

Bis zum nächsten Mal,
Philipp Raasch
Weitere Optionen:
Newsletter Weiterempfehlen (5 Referrals = 1 Monat Pro-Abo gratis)
